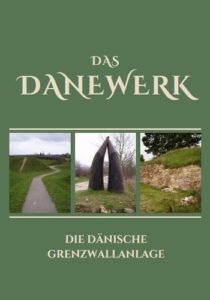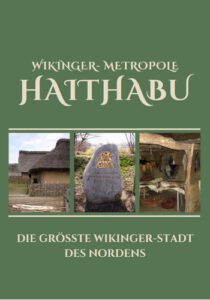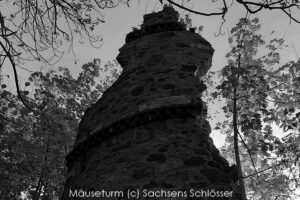Die Thyraburg
 Das Danewerk verfügte ehemals über drei Burgen, von denen noch die Thyraburg anhand des rechteckigen, mit Bäumen bewachsenen Plateaus zu erkennen ist. Außer der Grundfläche der aus Holz erbauten und damals von einem Graben umgebenen Burg zeugt nicht mehr viel von ihrem ehemaligen Bestehen. Die Stelle befindet sich an einer Landzunge, die in den inzwischen verlandeten Dannewerk-See hineinragt und vormals von einem Graben umgeben war.
Das Danewerk verfügte ehemals über drei Burgen, von denen noch die Thyraburg anhand des rechteckigen, mit Bäumen bewachsenen Plateaus zu erkennen ist. Außer der Grundfläche der aus Holz erbauten und damals von einem Graben umgebenen Burg zeugt nicht mehr viel von ihrem ehemaligen Bestehen. Die Stelle befindet sich an einer Landzunge, die in den inzwischen verlandeten Dannewerk-See hineinragt und vormals von einem Graben umgeben war.
Die Thyraburg wurde nach Thyra Danebod, Mutter von Harald Blauzahn, benannt. Sie lebte von etwa 870 bis 935 und veranlasste im 10. Jahrhundert den Ausbau der Wallburg. Errichtet wurde die Thyraburg als Befestigung am östlichen Ende des Danewerks zwischen dem Nord wall und dem Hauptwall. Die Erbauungszeit datiert schätzungsweise auf das 13. Jahrhundert. Das von Menschenhand aufgeschüttete Plateau ist etwa 35 m breit, 45 m lang und bis zu 5,5 m hoch. Es wird in der Forschung davon ausgegangen, dass auf dem Plateau eine hölzerne Turmhügelburg stand.
Die Waldemarzeitliche Burg
Die frühe Burg
Das vormalige Bestehen einer waldemarzeitlichen Burg bei Rothenkrug wurde anhand historischer Berichte erforscht und die gewonnenen Erkenntnisse 2015 veröffentlicht. 1583 wurden erstmals Ruinen eines Tores erwähnt. Die erste Vermutung des Bestehens einer Burg ist 1634 verzeichnet. Um 1720 wurden diese Vermutungen bestätigt. Die Burganlage entstand offenbar im 12. Jahrhundert. Von der Burg sind nur Reste der südlichen Erdfront erhalten geblieben. Im frühen 19. Jahrhundert war der nördliche Teil des Burgplateaus vollständig zerstört und abgetragen.
Die spätere Schanze
Auf dem Plateau der unbenannten Burg entstand zwischen 1658 und 1660 eine Schanze, welche Verteidigungszwecken gedient hatte. Lange Zeit fand diese Schanze nur wenig Beachtung. Die Schanze wurde erstmals um 1720 beschrieben. Sie befindet sich westlich des Ochsenwegs an der Kreisstraße 27 und nördlich des Hauptwalles nahe der 2022 abgerissenen Gaststätte Rothenkrug und des Danevirke Museums.
Der Schanzenbau wurde durch Kaiserliche Truppen fünfeckig in Sternenform gen Norden ausgeführt. Von dieser Schanze sind ebenfalls nur noch wenige Reste erhalten. Der Plateaurest ist nördlich vom Danevirke Museum zu erkennen. Er ragt augenscheinlich aus dem Wall heraus. Östlich zum Ochsenweg hin ist die Abgrenzung nur noch wage erkennbar. Die Schanze hatte ursprünglich einen Durchmesser von 75 m.
Der Kograben
 In der zweiten Bauphase wurde der Kograben angelegt. Dieser befindet sich etwa 2 km südlich des Danewerks und ist dem Hauptwall vorgelagert. Er erstreckte sich auf einer Länge von, je nach Quelle, 6,5 bis 7,6 oder gar 9 km von der Rheider Au bei Kurburg bis an die Südspitze des Selker Noors an der Schlei. Er ist schnurgerade, was eine frühzeitliche, architektonische Meisterleistung darstellt. Ursprünglich bestand die Anlage aus einem 2 m hohen und 7 bis 8 m breiten Erdwall, dem ein etwa 4 m breiter und 3 m tiefer Spitzgraben vorgelagert war.
In der zweiten Bauphase wurde der Kograben angelegt. Dieser befindet sich etwa 2 km südlich des Danewerks und ist dem Hauptwall vorgelagert. Er erstreckte sich auf einer Länge von, je nach Quelle, 6,5 bis 7,6 oder gar 9 km von der Rheider Au bei Kurburg bis an die Südspitze des Selker Noors an der Schlei. Er ist schnurgerade, was eine frühzeitliche, architektonische Meisterleistung darstellt. Ursprünglich bestand die Anlage aus einem 2 m hohen und 7 bis 8 m breiten Erdwall, dem ein etwa 4 m breiter und 3 m tiefer Spitzgraben vorgelagert war.
Auf der Seite zum Graben hin war die Böschung des Walls mit einer Holzpalisade versehen, die durch schräge Stützpfeiler zusätzlich gesichert wurde. Nach neueren archäologischen Untersuchungen mittels Radiokohlenstoffdatierung ist die Entstehung des Kograbens um 800 möglich. Dabei wird er mit dem Göttrikswall gleichgesetzt, der im Jahr 808 vom dänischen Wikingerkönig Gudfred, auch Göttrik genannt, aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen den Wikingern und den Franken unter Karl dem Großen angelegt wurde. Gudfred regierte von 804 bis zu seiner Ermordnung 810 von Haithabu aus. Da diese spezielle Palisadentechnik allerdings der Bauweise ähnelt, die erst viel später um 980 beim Bau dänischer Ringburgen angewandt wurde, ist die genaue Bauzeit nur schwer richtig zu datieren. Dadurch kann auch keine klare Aussage über den Auftraggeber gegeben werden.
Der Kograben als Schifffahrtsweg?
 Der Kograben war möglicherweise Teil des Schifffahrtweges zwischen Nordsee und Ostsee. Da die Jütland-Umschiffung als gefährlich galt, könnte für die Schifffahrt auch die Route über Eider, Treene, Rheider Au und Schlei genutzt worden sein. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Schiffe ab dem Selker Noor etwa einen Kilometer auf dem Trockenen gezogen wurden, um auf dem weiteren Weg bis zur Rheider Au den damals wasserführenden Kograben zu nutzen. Dazu musste ein Höhenunterschied von 25 m bewältigt werden. Weiterhin könnte der Kograben eine Schutzfunktion für den Handelsplatz Haithabu ausgeübt haben.
Der Kograben war möglicherweise Teil des Schifffahrtweges zwischen Nordsee und Ostsee. Da die Jütland-Umschiffung als gefährlich galt, könnte für die Schifffahrt auch die Route über Eider, Treene, Rheider Au und Schlei genutzt worden sein. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Schiffe ab dem Selker Noor etwa einen Kilometer auf dem Trockenen gezogen wurden, um auf dem weiteren Weg bis zur Rheider Au den damals wasserführenden Kograben zu nutzen. Dazu musste ein Höhenunterschied von 25 m bewältigt werden. Weiterhin könnte der Kograben eine Schutzfunktion für den Handelsplatz Haithabu ausgeübt haben.
Erhaltungsgrad
Der Kograben ist nicht mehr vollständig erhalten, sondern stellenweise unterbrochen. Ein nicht ganz 2 km langes Stück ist zwischen der K30 / Rheider Weg und dem Ochsenweg sichtbar. Ab der A7 ist der Kograben noch bis zur südlichen Spitze des Selker Noors auszumachen. Grabungen zufolge setzte sich die Befestigung einst bis zur Treene westlich von Hollingstedt fort. Damit war der Kograben sogar etwa 9 km lang. Heute verliert sich die Wallanlage in der Gegend des Ortes.
Der kurze Kograben
Etwa 300 m weiter südlich vor der Rheider Au war dem Kograben der Kleine Kograben oder auch der Kurze Kograben vorgelagert. Der Kurze Kograben wurde möglicherweise bereits vor dem Kograben errichtet. Er soll 2 m tief und 7,5 m breit gewesen sein. Seine spärlichen Überreste wurden 1841 entdeckt. Er erstreckte sich über eine Länge von 700 m und wurde im Jahre 1936 beim Bau des Flugplatzes vollständig eingeebnet.
Der Margarethenwall
 Je nach Quellenlage war der Margarethenwall etwa 3,3 km oder 4,5 km lang und 30 m breit. Er wurde in mehreren Bauphasen errichtet und verband den Hauptwall mit dem Halbkreiswall um Haithabu. Der erste Bauabschnitt wurde um 968 ausgeführt, darauf lassen analysierte Holzfunde schließen. Zu genau jener Zeit regierte König Harald Blauzahn. Bei Ausgrabungen wurde ein dreiphasiger Wallaufbau festgestellt.
Je nach Quellenlage war der Margarethenwall etwa 3,3 km oder 4,5 km lang und 30 m breit. Er wurde in mehreren Bauphasen errichtet und verband den Hauptwall mit dem Halbkreiswall um Haithabu. Der erste Bauabschnitt wurde um 968 ausgeführt, darauf lassen analysierte Holzfunde schließen. Zu genau jener Zeit regierte König Harald Blauzahn. Bei Ausgrabungen wurde ein dreiphasiger Wallaufbau festgestellt.
Der erste Wallbau war 13 m breit und 4 m hoch. Der zweite Wall war 17 m breit und 5 m hoch. Der dritte Wall schließlich erreichte eine Breite von 20 m und eine Höhe von bis zu 6,5 m. Außerdem verfügte der dritte Wallbau einen 2 m tiefen und 5,5 m breiten Wehrgraben. Eine Datierung für den Bau der dritten Ausführung konnte bislang noch nicht durchgeführt werden.
Der Margarethenwall hatte die Funktion eines Verbindungswall inne. Nordöstlich der Thyraburg traf er auf den Hauptwall und begann vormals am Ufer des zwischenzeitlich längst verlandeten Dannewerker Sees. An diesem Übergang war er auf einer Länge von ungefähr 800 m als Doppelwall angelegt und verlief danach weiter als einfacher Wall gen Osten.
Der Doppelwall entstand in zwei Bauphasen. Der erste Wallbau erfolgte 968 und war 13 m breit und 2 m hoch. In der zweiten Bauphase wurde der Wall 18 m breit ausgeführt. Dazu existierte gen Süden ein Vorwall von 11 m Breite und 2 m Höhe, der wohl bereits um 860 angelegt worden war. Im Bereich des Doppelwalls kurz vor dem Haithabuer Halbkreiswall gibt es eine kleine Lücke, die den Gegebenheiten des Originalbaus entspricht. An dieser vormals besonders feuchten Stelle wurde das Wallbauwerk mit einem dammartigen Holzunterbau versehen. Der Fällzeitraum des Holzes wurde auf 964 ⁄ 965 bestimmt.
Nördlich des Doppelwalls sind einige wenige Reste des zusätzlich errichteten Bogenwalls sichtbar. Dieser befindet sich in einem schlechten Erhaltungszustand. Der Margarethenwall selbst ist größtenteils recht gut erhalten. Vom Halbkreiswall Haithabu bis zur B77 verläuft er über etwa 300 m, gefolgt von einer kurzen Unterbrechung. Ab der Straße Bergholm in Busdorf ist er bis zur Autobahn A7 erhalten.
Die Margarethenwallstraße sowie kurz darauf ein Waldweg, eine Verlängerung der Straße Dannewerkredder, unterbrechen den Margarethenwall wiederholt. Auf der anderen Autobahn-Seite in Richtung Hauptwall ist der Margarethenwall für das geübte Auge noch auf einer Viehweide zu erahnen, verliert sich dann jedoch schnell.
Busdorfer Schlucht
 Neben der Unterbrechung durch den Autobahnbau verfügt der Margarethenwall über eine natürliche Unterbrechung: Die “Busdorfer Schlucht” ungefähr in der Mitte des Walls ist ein trockengelegter Teil des Busdorfer Teiches. An dieser Stelle ist der größte Höhenunterschied des Danewerks zu überwinden. Hier wird der Wall auch Reesendamm genannt.
Neben der Unterbrechung durch den Autobahnbau verfügt der Margarethenwall über eine natürliche Unterbrechung: Die “Busdorfer Schlucht” ungefähr in der Mitte des Walls ist ein trockengelegter Teil des Busdorfer Teiches. An dieser Stelle ist der größte Höhenunterschied des Danewerks zu überwinden. Hier wird der Wall auch Reesendamm genannt.
Der Verbindungswall könnte seinen Beinamen von einer der beiden dänischen Königinnen Margarete Sambiria “Swarte Gret” († 1282) oder Margarethe I. († 1412) erhalten haben. Auch wenn der Baubeginn des Walls, ausgehend vom früheren Sterbejahr von “Swarte Gret”, mindestens dreihundert Jahre zurückdatiert, könnte er später zur Erinnerung an sie vergeben worden sein. Eine Befestigung bei Missunde trug ebenfalls den Namen Margarethenwall, stand mit dem Danewerk aber in keiner Verbindung.
Der Ochsenweg
 Da der Abstand zwischen Nordsee und Ostsee im Bereich der Schleswigschen Landenge am kürzesten war, wurden Handel und Verkehr über die Halbinsel geführt. Das Danewerk übernahm auch hierfür eine Schutzfunktion. Es besaß, wie zunächst angenommen wurde, lediglich ein Tor, das Wieglesdor, durch welches der Grenzverkehr über den Ochsenweg, dessen dänischer Name Hærvejen (deutsch: Heerweg) lautet, führte. Entgegen dem dänischen Namen wurde der Weg nur selten als Marschroute genutzt. Vielmehr wurde darüber der Viehhandel abgewickelt, woraus der deutsche Name resultiert. Zur Abkürzung wurde der Heer- oder auch Ochsenweg später etwas in östliche Richtung verlegt. Die Route des Ochsenweges führte von Viborg in Dänemark nach Hamburg und Wedel.
Da der Abstand zwischen Nordsee und Ostsee im Bereich der Schleswigschen Landenge am kürzesten war, wurden Handel und Verkehr über die Halbinsel geführt. Das Danewerk übernahm auch hierfür eine Schutzfunktion. Es besaß, wie zunächst angenommen wurde, lediglich ein Tor, das Wieglesdor, durch welches der Grenzverkehr über den Ochsenweg, dessen dänischer Name Hærvejen (deutsch: Heerweg) lautet, führte. Entgegen dem dänischen Namen wurde der Weg nur selten als Marschroute genutzt. Vielmehr wurde darüber der Viehhandel abgewickelt, woraus der deutsche Name resultiert. Zur Abkürzung wurde der Heer- oder auch Ochsenweg später etwas in östliche Richtung verlegt. Die Route des Ochsenweges führte von Viborg in Dänemark nach Hamburg und Wedel.
Heute ist der Ochsenweg im Bereich des Danewerks ein Stück identisch mit einer Straße, die am mittlerweile abgerissenen Gasthof Rothenkrug vorüberführt. Hauptsächlich bietet sich das Bild eines breiteren Feld- und Wiesenweges, der teilweise durch die Anlage des Flugplatzes Jagel zerstört wurde. Nahe der Tweebargen sind an einem kleinen Parkplatz übermannsgroße Ochsenhörner zu finden.
Das Wieglesdor
Das Wieglesdor wurde einst als die einzige Passage durch das Danewerk dargestellt. Es diente vor allem der Abwicklung des Grenzverkehrs. Weitere urkundliche Bezeichnungen waren Weglaßthor, Heggedor, Heckenthor oder Hegthor. Das Wieglesdor wurde in den Reichsannalen von 808 sowie in einem Bericht nach Adam von Bremen im Jahre 974 genannt und war vermutlich bis um 1200 in Nutzung, bevor es verfüllt wurde.
Im August 2010 wurde verkündet, dass bei archäologischen Grabungen das lange verschollene Wieglesdor gefunden wurde. Der Fundort deckte sich mit Vermutungen über die Lage des Tores. Dem vorausgegangen war, dass 2008 ein ehemaliges Café abgerissen wurde, das einst auf dem heutigen Parkplatz des Danevirke Museums stand. Bei Ausgrabungen im Wall hinter dem ehemaligen Standort des Cafés wurde zunächst ein Teilstück der alten Feldsteinmauer freigelegt, bis ein ungefähr 6 m breiter Durchlass gefunden wurde. Eine Zollstation sowie eine Schänke mit Bordell sollen sich daneben befunden haben.
Weitere Tore im Danewerk
Mittlerweile konnten archäologische Befunde aufzeigen, dass das Danewerk nicht nur über ein, sondern über mehrere Tore verfügt hatte. Für den Kograben sind gleich zwei Tore bekannt. Ein Tor wurde bereits 1936 entdeckt, als bei Erdarbeiten auf dem Flugplatz Jagel eine 36 m breite Lücke ohne Spuren von einem Wall oder Graben freigelegt worden ist. An dieser Stelle querte die Alte Landstraße den Kograben und kreuzte im weiteren Verlauf den Margarethenwall, weshalb auch in diesem ein Tor vermutet wird.
Das zweite, deutlich kleinere Tor wurde 1972 östlich des Flugplatzes während des Ausbaus der Autobahn gefunden. Hier querte ein Feldweg den Kograben. Die Lücke ohne Wallspuren ist an dieser Stelle etwa 4 m breit. Aufgrund der beiden Tore ist es allerdings fraglich, ob der Kograben früher tatsächlich wasserführend gewesen sein konnte. Im Osterwall, der vom Ochsenweg gequert wird, befand sich ein weiteres Tor.
Das Schlei-Sperrwerk
Das Schlei-Sperrwerk, gelegen an der Großen Breite an der Halbinsel Reesholm gegenüber von Stexwig an der ehemaligen Insel und heutigen Untiefe Kockbarg, entstand als Seesperrwerk in der ersten Bauphase des Danewerks. Es wurde im 8. Jahrhundert errichtet und war zwischen mehr als 900 m und etwa 1.200 m lang. Ungefähr 5 x 5 m große Blöcke aus Holzplanken wurden im Boden der Schlei verankert und ragten aus ihr heraus. Damit wurde vermutlich eine alte Furt bei Borgwedel abgesperrt und gleichzeitig eine bestehende Lücke in der Landesverteidigung geschlossen.
Anhand dendrochronologischer Untersuchungen konnte die Bauzeit dieses bemerkenswerten Sperrwerkes auf die Zeit um 737 bis 740 datiert werden. Es wurde zwischen 1925 und 1928 eher zufällig bei Baggerarbeiten in der Schlei entdeckt, erhielt aber nicht die erforderliche Aufmerksamkeit. Erst 1992 wurde diese Stelle der Holzbalkenfunde wiederentdeckt und genauer untersucht. Ergebnis der damaligen Forschungen war unter anderem, dass das Sperrwerk in früherer Zeit begehbar und sogar mit Gebäuden bebaut war. Heute liegen die Überreste unter Wasser.
Die Tweebargen
 Nordwestlich vom Flugplatz Jagel befinden sich am Kograben die Tweebargen. Die zwei Hügelgräber gehören zu einer Kette von Grabhügeln, die einst aus mehr als 80 Monumenten entlang des Ochsenwegs am Danewerk bestand. Erhalten sind vier Grabhügel westlich des Ochsenweges. Die Grabhügel der Tweebargen haben einen Durchmesser von 35 m. Sie stehen unter Denkmalschutz und sind 4,20 bzw. 4,40 m hoch und über einen Zwiebackweg genannen Weg über den Kograben zu erreichen. Die beiden kleineren Grabhügel befinden sich einige Meter nordwestlich beziehungsweise südöstlich entfernt.
Nordwestlich vom Flugplatz Jagel befinden sich am Kograben die Tweebargen. Die zwei Hügelgräber gehören zu einer Kette von Grabhügeln, die einst aus mehr als 80 Monumenten entlang des Ochsenwegs am Danewerk bestand. Erhalten sind vier Grabhügel westlich des Ochsenweges. Die Grabhügel der Tweebargen haben einen Durchmesser von 35 m. Sie stehen unter Denkmalschutz und sind 4,20 bzw. 4,40 m hoch und über einen Zwiebackweg genannen Weg über den Kograben zu erreichen. Die beiden kleineren Grabhügel befinden sich einige Meter nordwestlich beziehungsweise südöstlich entfernt.
Der Sage nach soll der legendäre König Dan von Dänemark in einem der Tweebargen-Hügel auf seinem Königsstuhl sitzend zusammen mit seinem Pferd in einer Felsenkammer begraben sein. So erklärt sich auch der Beiname Danhöje oder dänisch Danhøje. Aber auch in Eiderstedt bei Tönning gibt es solch einen Erdhügel mit Höhle, über den genau diese Sage erzählt wird. Darin sitzt König Dan mit seiner Gefolgschaft. Ein zum Tode verurteilter Soldat war beauftragt zu berichten, was er in der Höhle sähe. Er traf auf den schlafenden König Dan, dem sein Bart mittlerweile lang gewachsen war. König Dan trug dem Soldaten auf zu berichten, er werde zur rechten Zeit wiederkommen und Hilfe bringen, und der König, welcher den Soldaten in die Höhle schickte, werde dann über die ganze Welt herrschen.
Das kommt bekannt vor? Schon mal so ähnlich gehört? König Friedrich I., genannt Barbarossa, sitzt schlafend mit lang gewachsenem Bart im Kyffhäuser und will ebenfalls wiederkommen, wenn sein Volk ihn braucht.
Die Waldemarsmauer
 Die Waldemarsmauer ist eine Ziegelmauer, die auf Anordnung von König Waldemar I. dem Großen etwa ab 1165 errichtet wurde, Höhepunkt und Endphase der Danewerk-Bautätigkeiten. Sie sollte der Verstärkung des Hauptwalls dienen. Vermutlich handelt es sich bei der Mauer um die älteste ihrer Art in Nordeuropa.
Die Waldemarsmauer ist eine Ziegelmauer, die auf Anordnung von König Waldemar I. dem Großen etwa ab 1165 errichtet wurde, Höhepunkt und Endphase der Danewerk-Bautätigkeiten. Sie sollte der Verstärkung des Hauptwalls dienen. Vermutlich handelt es sich bei der Mauer um die älteste ihrer Art in Nordeuropa.
Ursprünglich umfasste die Waldemarsmauer eine Länge von, je nach Quellenlage, rund 3,5 bis 4,5 km, eine Höhe von 5 bis 7 m und eine Breite von bis zu 1,8 m. Sie besaß Zinnen und einen Wehrgang aus Holz, der seitlich an der Maueroberkante vorbei lief. Ihr vorgelagert war zum Schutz ein 15 bis 22 m breiter und zweieinhalb Meter tiefer Graben. Der dahinter liegende Wall war 18 m breit und 4 m hoch. Beim Tod von König Waldemar I. war der Bau der Mauer noch nicht beendet. Ob ihr Bau jemals tatsächlich fertig gestellt wurde, bleibt offen.
Abtragung der Waldemarsmauer
Nachdem das Danewerk aufgegeben wurde, wurden große Teile der Waldemarsmauer abgetragen und ihre Ziegel noch bis ins zeitige 19. Jahrhundert als Baumaterial genutzt. Möglicherweise wurden auch beim Bau von Schloss Gottorf in Schleswig Steine aus der Waldemarsmauer verwendet. Der Großteil der erhaltenen Überreste der Waldemarsmauer befindet sich etwa 100 m vom Danevirke Museum entfernt. Das etwa 50 m lange Mauerstück wurde 1863 freigelegt, als ein Teil des Hauptwalls zu der militärischen Schanze 14 umgebaut wurde. Auch im Wall westlich der K39 von Dannewerk in Richtung Ellingstedt sind kleinere Mauerreste zu sehen.
Restauration der Waldemarsmauer
Die Reste der Waldemarsmauer wurden ab 2006 bis 2008 umfangreichen Sanierungs- und Sicherungs arbeiten unterzogen. Ein extra dafür aufgestelltes Schutzzelt wurde 2008 offenbar zu zeitig wieder abgenommen, weshalb die notwendigen chemischen Reaktionen im Zuge der Mauersanierung nicht vollständig ablaufen konnten. Noch im gleichen Jahr begann der neu eingebrachte Kalkmörtel zu bröckeln und im Herbst 2015 war der Mörtel vollkommen ausgewaschen. Letztlich befand sich die Waldemarsmauer in einem schadhafteren Zustand als vor der Sanierung.
Der Krummwall
Der Krummwall wurde auf einer Länge von etwa 6,5 km errichtet. Er verband den südwestlichen Teil des Hauptwalles mit Hollingstedt und gilt als unmittelbare Fortsetzung des Hauptwalls an der Schanze 19, stellt jedoch keine bauliche Einheit in sich dar. Der Krummwall war teils mit und teils ohne Palisadenwall erschaffen worden. An verschiedenen Stellen konnten insgesamt bis zu drei Bauphasen nachgewiesen werden.
Der bis zu 2,5 m hohe Krummwall ist mittlerweile nicht mehr komplett erhalten. Wegdurchschnitte und Einebnungen kennzeichnen seinen Gesamtverlauf. Wallreste haben sich auf jenen Flächen erhalten, die aufgrund von moorigem Untergrund in Verbindung mit einem hohen Grundwasserstand für den Ackerbau ungeeignet sind. Der Name Krummwall geht vermutlich auf seine kurvige, nicht geradlinige Ausführung zurück. Bereits im 17. Jahrhundert wurde er als „Krumbwal“ bezeichnet.
Ende des Krummwalls
Die Wallanlage des Krummwalls ist bis zur Ortschaft Morgenstern ziemlich gut erforscht. Noch nicht eindeutig erwiesen ist, ob der Krummwall bis zur Treene in Hollingstedt ausgebaut worden ist. Möglicherweise endete er bereits östlich der Gehöftgruppe Matzenkamp in den Wiesen auf dem Flurstück Achterwall. Dort ist der Wall 20 m breit und es konnten drei Bauphasen festgestellt werden.
Die in den historischen Quellen niedergeschriebenen Aussagen über den Ausbau des Krummwalls bis Hollingstedt gehen auf jahrhundertelang mündlich überlieferte Berichte der Bevölkerung zurück. Als die älteste schriftliche Quelle ist ein Schriftstück vom Husumer Caspar Danckwerth bekannt, welcher 1652 die “Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Schleswich und Holstein zusambt vielen dabeij gehörigen Newen Landkarten” veröffentlichte und eben jenen Ausbau des Krummwalls bis zur Treene in Hollingstedt beschrieb.
Hollingstedts Umwallung
Schon um 1641 wurde Hollingstedt auf mehreren Karten mit einer Umwallung dargestellt, wobei die Forschung noch keinen definitiven Nachweis für diesen Ausbau erbringen konnte. Ein Grund könnte sein, dass, wie ebenfalls in der historischen Quelle von Danckwerth überliefert ist, das Wallstück schon im Mittelalter abgetragen worden ist, um den Wallgraben aufzufüllen. Diese Aussage wird in einer Beschreibung aus dem frühen 18. Jahrhundert wiederholt.
In der Wikingerzeit war Hollingstedt der Nordseehafen von Haithabu, im späteren Mittelalter der von Schleswig. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich die Landschaft durch natürliche Einflüsse und menschliche Eingriffe. So lässt sich auch erklären, dass die noch bis ins Hochmittelalter bis Hollingstedt schiffbare Treene heute teils verlandet, teils als Auenlandschaft erhalten ist. Möglicherweise war Hollingstedt als wichtiger Umschlagplatz für den Ost-West-Handel ebenso in das Verteidigungssystem des Danewerks einbezogen wie Haithabu.
Hollingstedt ist gewachsen und dementsprechend überbaut worden. Etwas westlich von Schlott ist eine leichte Bodenerhebung erkennbar, die in einen Feldweg übergeht und am Treene-Deich endet. Es könnte sich hierbei vermutlich um den südlichen Arm der Umwallung Hollingstedts und damit um die Fortsetzung des Krummwalls handeln. Bereits 1841 wurde festgestellt, dass mehrere Häuser auf dem nach Norden führenden abgeflachten Wall stünden, der nördlich vom Ort am Wiesenweg endet. Damit könnte ein Anzeichen für den nördlichen Arm der Hollingstedt-Umwallung vorliegen. Was demnach noch aussteht, ist eine umfassende Untersuchung dieser weniger als einen halben Meter hohen Erhebungen.
Der Nordwall
Der Nordwall wurde um 1720 erwähnt und ist erstmals 1757 auf einer Karte zu finden. 1842 wurde er in einschlägiger Literatur als Alter Wall bezeichnet. Einst auf einer Länge von etwa 1.600 m angelegt, ist er heute nur noch über rund 700 m vorhanden und stark verflacht. Der Nordwall verlief fast gerade vom Westende der Schlei bis zum verlandeten Danewerker See. Noch recht gut zu erkennen ist der Nordwall beidseits der Straße Holzredder in Schleswig auf einer Weide.
Ausgrabungen fanden sowohl in den frühen 1930er als auch wiederholt in den zeitigen 1970er Jahren statt. Dabei wurde rekonstruiert, dass der Nordwall ursprünglich zwischen 14 und 15 m breit war. Zum Teil war der Wall mit Holzpfosten an der Frontseite verstärkt und im Bereich des Pulverholzbaches mit einem massiven Rahmenwerk aus Eichenholz. Davor lag ein 3 m breiter Absatz und wiederum davor ein 5 m breiter und 3 m tiefer Wehrgraben. Anhand dendrochronologischer Untersuchungen konnte eine Entstehungszeit um 737 bestimmt werden.
Der Osterwall
Einige Kilometer entfernt nahe Eckernförde befand sich der Osterwall (dänisch: Østervold), der mit dem eigentlichen Danewerk in keiner direkten baulichen Verbindung stand. Der Osterwall bildete damals den östlichen Teil der gigantischen Schutzanlage. Besondere Bedeutung kam dem Osterwall zu, da er nicht nur ins Verteidigungssystem des Danewerks integriert war, sondern gleichzeitig auch Bestandteil weiterer Verteidigungsanlagen an der jütländischen Landenge war.
Der Osterwall erstreckte sich über etwa 3,5 km und er reichte vom Windebyer Noor bei Eckernförde im Osten bis zur Großen Breite der Schlei im Westen. Er diente der Sicherung der Halbinsel Schwansen und verhinderte zusätzlich eine Umgehung der Hauptwälle des Danewerks zwischen Haithabu und Hollingstedt. Einst war er bis zu 3,5 m hoch und bis zu 7,5 m breit. Der Osterwall wird von einem Hohlweg gequert, der älter als der Wall selbst ist.
Die Entstehungszeit des Ostwalls, wie er auch genannt wird, wird im Zeitraum von etwa 700 bis um das Jahr 737 vermutet. Archäologische Ausgrabungen zwischen 1972 und 1981 ergaben, dass die Aufschüttung des Walls offenbar in zwei Bauphasen erfolgte und der Wall aus zwei Abschnitten bestand. Zunächst entstand um 700 der östliche Abschnitt nahe des Windebyer Noors. Hier hatte der Osterwall einen zusätzlichen Graben erhalten. Der westliche Bereich des Osterwalls an der Großen Breite wurde auf 737 datiert. In diesem Bereich konnte eine frühere hölzerne Palisade nachgewiesen werden. Der Osterwall verfügte weiterhin über ein Tor. An dieser Stelle, an welcher ein Weg gekreuzt wurde, verlaufen die beiden Wallenden ein Stück nebeneinander, so dass sich ein Versatz ergab.
Der Osterwall wurde nach der Wikingerzeit jedoch nicht weiter ausgebaut und ist heute nur stellenweise und extrem abgeflacht noch zu erkennen. Sichtbare Abschnitte von einer Höhe von bis zu 3 m befinden sich zwischen Kochendorf und Möhlhorst sowie in einem Waldstück in Dürwade. In Kochendorf wurde der Wall teilweise überbaut. In der Nähe des Osterwalls konnten sechs weitere Kurzwälle ausgemacht werden. Diese sind teilweise nur durch Luftaufnahmen überhaupt noch erkennbar. Ihre Funktion sowie ihre eventuelle Verbindung zum Osterwall konnten bislang noch nicht erforscht werden. Nebenwälle gibt es in Christianshöh und in Schnaap. Nördlich des Bültsees verläuft über 1,4 km ein Nebenwall parallel zum Osterwall.
Weitere Wälle
Alter Wall auf Reesholm
Auf der Halbinsel Reesholm war mit dem 270 m langen Alten Wall ein weiterer Wall mit Schutzfunktion vorhanden. Er sicherte eine Furt bei Stexwig.
Stummes Werk
Eine erste Eintragung des etwa 860 m langen Stummen Werks auf einer Karte erfolgte 1757. Es trifft im Westen auf den heute trockenen Dannewerker See und geht im Osten in den Nordwall über. Der noch undatierte Bau wurde so ausgerichtet, dass er zum Schutz gegen Angriffe aus Richtung Norden diente. Heute ist das Stumme Werk sehr stark verschleift und dadurch schwer auszumachen.
Wälle im Thiergarten von Schleswig
Im bewaldeten ehemaligen Thiergarten von Schloss Gottorf in Schleswig befinden sich zwei Wallzüge, die bislang noch undatiert und nicht konkret zuordenbar sind. Sie sind jeweils etwa 400 m lang und verfügen über nach Westen vorgelagerte Gräben.
Vorherige Seite: Danewerk | Dänischer Grenzwall
Nächste Seite: Die Reaktivierung des Danewerks