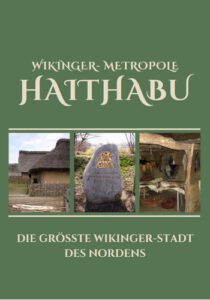Die Metropole der Wikinger
 Die einst größte Wikingerstadt des Nordens und der bedeutendste Handelsplatz der Dänen wurde durch einen Halbkreiswall geschützt und in die Grenzwallanlage des Danewerks eingebunden. Die Metropole Haithabu mit ihren vermutlich anderthalbtausend Einwohnern stand im 10. Jahrhundert in ihrer Blütezeit.
Die einst größte Wikingerstadt des Nordens und der bedeutendste Handelsplatz der Dänen wurde durch einen Halbkreiswall geschützt und in die Grenzwallanlage des Danewerks eingebunden. Die Metropole Haithabu mit ihren vermutlich anderthalbtausend Einwohnern stand im 10. Jahrhundert in ihrer Blütezeit.
Haithabu konnte sich nach einer zweimaligen Zerstörung, zuletzt im Jahre 1066, nicht mehr erholen. Ein Wiederaufbau erfolgte nicht. Vielmehr verlegten die Einwohner ihre Siedlung an das andere Ufer der Schlei. Schleswig darf somit als Nachfolgesiedlung von Haithabu angesehen werden. Das zerstörte Haithabu verfiel weiter. Der Wasseranstieg von Ostsee und Schlei ließ die Überreste schließlich versinken und vergessen.
Die Geschichte von Haithabu
 Mit der Völkerwanderung rückten die Dänen und die Jütländer in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts in das bis dahin dünn besiedelte Land um Schlei und Eckernförder Bucht vor. Haithabu wurde spätestens um das Jahr 770 südlich des heutigen Walls gegründet und hält den Status inne, die älteste Stadt auf ehemaligem dänischem Gebiet zu sein. Im 9. Jahrhundert entstanden zwei weitere Siedlungen, eine nördlich des Walls und eine zwischen den beiden Siedlungen am Haithabu-Bach. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts wurden der nördliche und südliche Teil wieder aufgegeben. Die mittlere Siedlung blieb bestehen und wurde in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts durch einen Halbkreiswall in die Grenzanlage des Danewerks integriert.
Mit der Völkerwanderung rückten die Dänen und die Jütländer in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts in das bis dahin dünn besiedelte Land um Schlei und Eckernförder Bucht vor. Haithabu wurde spätestens um das Jahr 770 südlich des heutigen Walls gegründet und hält den Status inne, die älteste Stadt auf ehemaligem dänischem Gebiet zu sein. Im 9. Jahrhundert entstanden zwei weitere Siedlungen, eine nördlich des Walls und eine zwischen den beiden Siedlungen am Haithabu-Bach. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts wurden der nördliche und südliche Teil wieder aufgegeben. Die mittlere Siedlung blieb bestehen und wurde in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts durch einen Halbkreiswall in die Grenzanlage des Danewerks integriert.
Haithabu avancierte schon bald als Hafenstadt zum bedeutendsten Handelszentrum der Dänen. Dazu trugen Handelsbeziehungen mit dem Baltikum, der südlichen Ostseeküste sowie Nord- und Westeuropa bei. Auch mit der später untergegangenen Stadt Vineta sowie mit Ralswiek wurden Handelsbeziehungen gepflegt. Weiterhin dienten die Zerstörung des konkurrierenden slawischen, später ebenfalls untergegangenen und sagenumwobenen Handelsortes Reric im Jahr 808 und die Zwangsumsiedlung der Rericer Kaufleute nach Haithabu dessen Aufstieg. Im 10. Jahrhundert erreichte Haithabu seine Blütezeit und zählte mindestens 1.500 Einwohner.
König Gudfred und Sliasthorp
Der dänische König Gudfred regierte von 804 bis zu seiner Ermordung 810 von Haithabu aus. Er gilt als Begründer von Schleswig, welches 804 erstmals als “Sliasthorp” erwähnt wurde, und ließ zur Sicherung von Haithabu das Danewerk um den vorgelagerten Kograben erweitern.
810 soll unter Karl dem Großen eine Grenzmark des Fränkischen Reichs gegen die Dänen errichtet worden sein, die Dänische Mark oder auch Mark Schleswig, die sich nördlich der Eider bis zum Danewerk sowie zwischen Husum und Schleswig erstreckte. Sie könnte aber auch erst entstanden sein, als König Heinrich I. 934 in der “Schlacht von Haithabu” die Dänen besiegte und die Stadt eroberte. Bis dahin hatte König Chnuba, aus einer schwedischen Dynastie stammend, über die Stadt Haithabu geherrscht.
 Heinrich I. bezog als neuer Markgraf seine Residenz in Haithabu. Damit fiel das Gebiet für etwa ein Jahrhundert an das Heilige Römische Reich. Als Verbindung des Fränkischen Reichs mit Skandinavien in der Süd-Nord-Ausdehnung sowie zwischen der Ostsee und Nordsee in der Ost-West-Ausbreitung stieg es zum zentralen Warenumschlagplatz auf.
Heinrich I. bezog als neuer Markgraf seine Residenz in Haithabu. Damit fiel das Gebiet für etwa ein Jahrhundert an das Heilige Römische Reich. Als Verbindung des Fränkischen Reichs mit Skandinavien in der Süd-Nord-Ausdehnung sowie zwischen der Ostsee und Nordsee in der Ost-West-Ausbreitung stieg es zum zentralen Warenumschlagplatz auf.
Bereits um 850 war in Haithabu die erste christliche Kirche errichtet worden, vermutlich unter dem Erzbischof Ansgar von Hamburg. Obwohl dieser Bau urkundlich belegt ist, konnte er bislang archäologisch bis auf eine aus dem 10. Jahrhundert stammende, 1978 geborgene Bronzeglocke noch nicht nachgewiesen werden. Nachdem Kaiser Otto Haithabu besucht hatte, wurde die Stadt 948 Bischofssitz. Im gleichen Jahr hatte der dänische König Harald Blauzahn die Hoheit des Kaiserreiches anerkannt. 983 eroberte er Haithabu von den Franken zurück, auch wenn die Stadt noch um das Jahr 1000 zum Machtbereich des deutschen Kaisers zählte.
1050 wurde die Handelsstadt in einer Schlacht zwischen Harald Hardrada von Norwegen und Sweyn II. zerstört. Der sie umgebende neun Meter hohe Wall mit zusätzlicher Palisade hielt den Kämpfen nicht stand. Der Wiederaufbau erfolgte nur teilweise. Die Slawen plünderten und zerstörten Haithabu 1066. Daraufhin verlegten die Einwohner ihre Siedlung an das andere Schlei-Ufer nach Schleswig, das Haithabus Erbe übernahm. Vermutlich war auch der Hafen mittlerweile zu klein für die immer größeren Handelsschiffe geworden. Haithabu wurde nicht wieder aufgebaut und ging verloren.
Schleswig wurde später Hauptstadt des Herzogtums Schleswig und hat heute etwa 25.500 Einwohner. Zu den sehenswerten Bauwerken in Schleswig zählen das Schloss Gottorf mit dem Riesenglobus, der Dom und der Wikingturm.
Die Siedlung der Wikinger
 Haithabu war zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert ein Siedlungsplatz der Wikinger und eines der bedeutendsten wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Zentren des Nordens. Nach damaligen Maßstäben konnte Haithabu als Weltstadt des Mittelalters bezeichnet werden. Es war Hauptumschlagsplatz zwischen Skandinavien, dem Nordseeraum und dem Baltikum. Im Jahre 1066, das Jahr, in dem auch die Wikinger-Zeit endete, wurde Haithabu bei einem Brand zerstört und nicht wieder aufgebaut. Die in Vergessenheit geratene Siedlung wurde erst 1897 wiederentdeckt.
Haithabu war zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert ein Siedlungsplatz der Wikinger und eines der bedeutendsten wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Zentren des Nordens. Nach damaligen Maßstäben konnte Haithabu als Weltstadt des Mittelalters bezeichnet werden. Es war Hauptumschlagsplatz zwischen Skandinavien, dem Nordseeraum und dem Baltikum. Im Jahre 1066, das Jahr, in dem auch die Wikinger-Zeit endete, wurde Haithabu bei einem Brand zerstört und nicht wieder aufgebaut. Die in Vergessenheit geratene Siedlung wurde erst 1897 wiederentdeckt.
Haithabu war von einem noch gut erhaltenen Halbkreiswall von etwa 600 m Durchmesser umgeben. Es lag südlich der Stadt Schleswig am Haddebyer Noor zwischen Nordsee und Ostsee. In der Nähe befinden sich das Danewerk, das Haithabu zusätzlich schützte, sowie der historische Heerweg, auch als Ochsenweg bekannt. Heute heißt das Gebiet um Haithabu Haddeby und gehört zur Gemeinde Busdorf im Kreis Schleswig-Flensburg. Das Gelände innerhalb des 1,3 km langen und bis zu 10 m hohen Halbkreiswalls ist etwa 26 ha groß.
Das Rätsel um den Namen
Lange Zeit war die Namensgebung unklar. Haethum in angelsächsischen Quellen vom Ende des 9. Jahrhunderts und Haithabu auf Runensteinen aus dem 10. Jahrhundert einerseits, Sliesthorp in den Fränkischen Reichsannalen aus dem zeitigen 9. Jahrhundert und Sliasvich bei Rimbart in der Mitte des gleichen Jahrhunderts andererseits, führten zu Verwirrung und zu der Frage, ob mit Haithabu und Schleswig vielleicht zwei Siedlungen parallel bestanden haben könnten.
Bodenfunde ließen diese Möglichkeit jedoch wieder verwerfen. Die Umsiedlung der Einwohner von Haithabu nach Schleswig erfolgte wahrscheinlich in der Mitte des 11. Jahrhunderts. Viel wahrscheinlicher ist, dass mehrere Namen aufgrund der verschiedenen Bevölkerungsstämme benutzt wurden und diese im Laufe der Jahrhunderte, als die Siedlung innerhalb des Halbkreiswalls bestanden hatte, angepasst worden waren. Der Name Haithabu geht vermutlich auf die Dänen und der Name Sliasvich auf die Sachsen zurück. Die Siedlung am Nordufer der Schlei wurde nach der Aufgabe von Haithabu letztendlich Schleswig genannt.
Handelsschauplatz der Wikinger
 Haithabu lag strategisch günstig an der Kreuzung von zwei wichtigen Handelsrouten. Die Nord-Süd-Verbindung von Viborg in Jütland nach Hamburg führte nur wenige Kilometer westlich von Haithabu über den Ochsenweg. In West-Ost-Richtung gab es die Seehandelsroute zwischen Nordsee und Ostsee, die über die Flüsse Eider, Treene, Rheider Au und Schlei führte. Die eine Theorie besagt, dass die Schiffe von der Rheider Au zum Selker Noor über Land gezogen wurden, eine zweite These sieht den Kograben des Danewerks als ehemals wasserführenden Schifffahrtskanal.
Haithabu lag strategisch günstig an der Kreuzung von zwei wichtigen Handelsrouten. Die Nord-Süd-Verbindung von Viborg in Jütland nach Hamburg führte nur wenige Kilometer westlich von Haithabu über den Ochsenweg. In West-Ost-Richtung gab es die Seehandelsroute zwischen Nordsee und Ostsee, die über die Flüsse Eider, Treene, Rheider Au und Schlei führte. Die eine Theorie besagt, dass die Schiffe von der Rheider Au zum Selker Noor über Land gezogen wurden, eine zweite These sieht den Kograben des Danewerks als ehemals wasserführenden Schifffahrtskanal.
In Haithabu wurden eigene Münzen geprägt und Waren aus der gesamten damals bekannten Welt gehandelt. Aus Irland, Norwegen, Schweden, dem Frankenreich, England und dem Baltikum kamen überwiegend Rohstoffe, während Luxusgüter, dazu zählten unter anderem Gewürze, hauptsächlich aus Bagdad und Konstantinopel importiert wurden. Funde von eisernen Fuß- und Handfesseln lassen darauf schließen, dass Haithabu sehr wahrscheinlich auch ein größerer Marktplatz für den Sklavenhandel war.
Beste Voraussetzungen
Die Voraussetzungen für Haithabu waren optimal, um zu einer bedeutenden Stadt heranzuwachsen. So führten neben dem Seehandel auch die Zuwanderung von Handwerkern und die zwangsweise Ansiedlung von Kaufleuten aus dem vom Dänenkönig Gudfred zerstörten Reric zu einem Anstieg der Einwohnerzahl. Die Bevölkerung von Haithabu war nicht auf ihre Selbstversorgung angewiesen. Die Bauern aus der näheren Umgebung erzielten einen Getreideüberschuss, den sie in die Stadt verkauften. So konnten sich in Haithabu viele andere Berufe etablieren und Handwerker spezialisieren.
In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts, in der Zeit, als Haithabu vorübergehend zum Heiligen Römischen Reich gehörte, gewannen die Herstellung und Bearbeitung von Tonwaren, Glas und Werkzeug an Bedeutung. Die große Anzahl an gefundenen bunten Glasperlen lässt einerseits den Rückschluss auf Schmuckherstellung zu, andererseits avancierten Glasperlen im Frühmittelalter in Europa zu einer begehrten Handelsware, die als Zahlungsmittel im Tausch gegen Elfenbein, Edelmetalle, Gewürze und Stoffe eingesetzt wurde. Angesichts dessen galten aus Glasperlen gefertigte Schmuckstücke als besonders wertvoll und seine Trägerinnen und Träger als reich.
Der Bericht eines Zeitgenossen
 Ein jüdischer Kaufmann, der unter dem arabischen Namen Ibrahim ibn Ya’qub al-Tartuschi im Auftrag des Kalifen von Cordoba reiste, berichtete 965 über Haithabu, die Stadt am anderen Ende des Weltmeeres hätte: “… wenig an Vermögen und Schätzen zu bieten. Die Einwohner essen hauptsächlich Fisch, den es reichlich gibt. Die Menschen werfen ein Neugeborenes häufig lieber ins Meer, als es aufzuziehen.” Er erklärte diese Ungeheuerlichkeit damit, dass so Kosten gespart würden. Ob diese Kindsertränkungen wirklich geschehen sind?
Ein jüdischer Kaufmann, der unter dem arabischen Namen Ibrahim ibn Ya’qub al-Tartuschi im Auftrag des Kalifen von Cordoba reiste, berichtete 965 über Haithabu, die Stadt am anderen Ende des Weltmeeres hätte: “… wenig an Vermögen und Schätzen zu bieten. Die Einwohner essen hauptsächlich Fisch, den es reichlich gibt. Die Menschen werfen ein Neugeborenes häufig lieber ins Meer, als es aufzuziehen.” Er erklärte diese Ungeheuerlichkeit damit, dass so Kosten gespart würden. Ob diese Kindsertränkungen wirklich geschehen sind?
Weiterhin berichtete er von einer Kirche, wobei die meisten Einwohner dennoch Sirius verehren und zu dessen Ehren ausschweifende Ess- und Trinkgelage abhalten würden. Außerdem wusste Ibrahim ibn Ya’qub al-Tartuschi zu berichten, dass er noch nie “einen so grauenvollen Gesang gehört” habe, der “wie ein Knurren aus ihren Kehlen, wie Hundegebell, nur noch tierischer” klinge.
Aufgrund der Einseitigkeit sind diese Berichte mit Vorsicht zu genießen. Sie resultierten vermutlich aus den gravierenden kulturellen Unterschieden zwischen dem Juden und der Stadt. Positiv äußerte sich der Kaufmann hingegen über ein Detail, das hauptsächlich der weiblichen Bevölkerung zukommt: “Sie haben künstliche Schminke für die Augen. Wenn sie sie auftragen, ist es nicht zum Nachteil ihrer Schönheit; im Gegenteil, sie wird bei Männern wie Frauen noch betont.”
Die Siedlung von Haithabu
 Bei den Ausgrabungen und den Forschungen in den 1930er Jahren wurden unter anderem im Hafenbereich von Haithabu Materialien gefunden, die auf Wohnhäuser in zweierlei Bauausführung zurückzuführen sind. Herbert Jankuhn schloss daraus, dass in Haithabu wenigstens zwei unterschiedliche Bevölkerungsarten ansässig waren, einerseits nordischer, also wikingischer, andererseits westgermanisch-friesischer Herkunft. Unterschiede in aufgefundenen kunstgewerblichen Erzeugnissen bestätigen diese These.
Bei den Ausgrabungen und den Forschungen in den 1930er Jahren wurden unter anderem im Hafenbereich von Haithabu Materialien gefunden, die auf Wohnhäuser in zweierlei Bauausführung zurückzuführen sind. Herbert Jankuhn schloss daraus, dass in Haithabu wenigstens zwei unterschiedliche Bevölkerungsarten ansässig waren, einerseits nordischer, also wikingischer, andererseits westgermanisch-friesischer Herkunft. Unterschiede in aufgefundenen kunstgewerblichen Erzeugnissen bestätigen diese These.
Funde aus dem 10. und 11. Jahrhundert im Bereich der Bachniederung gaben Aufschluss über die damalige Stadtbebauung. Nach einer Brandkatastrophe wurde das Bachbett gegen Ende des 11. Jahrhunderts neu eingefasst. Anhand der Funde wird vermutet, dass die Häuser aus Holz und Flechtwerkwänden bestanden hatten und mit Reet oder Stroh gedeckt waren. Sie hatten Grundflächen zwischen 3,5 x 17 m und 7 x 17,5 m. Die einzelnen Gehöfte waren durch Holzzäune voneinander getrennt, bestanden jeweils aus mehreren Häusern und verfügten über eigene Brunnen.
Im Zentrum bestand die frühe Siedlung hauptsächlich aus geradlinigen Straßen und Gräben sowie einem Brunnen. Durch den Bach, der sich ein Stück südlicher vom heutigen Bachlauf durch das Gebiet schlängelte und im 10. Jahrhundert eine Holzeinfassung hatte, sowie einen Weg wurde Haithabu in vier Viertel gegliedert. Funde wie Gussformen und ein Glasschmelzofen, der auf den Überresten eines abgebrannten Grubenhauses errichtet worden war, belegten, dass im Nord-Ost-Viertel die Handwerker angesiedelt waren. Die Nähe zum Bach und die Entfernung von den Wohnhäusern diente dem Schutz der gesamten Siedlung.
 Alte Aufzeichnungen berichten von zwei Brücken, die Haithabu einst mit Schleswig verbunden haben sollen. Möglicherweise könnten damit aber einfach die Landungsbrücken gemeint sein. 2007 wurde eine um 1090 erbaute Landungsbrücke in Schleswig ausgegraben, die Teil einer Hafenanlage gewesen war. Der Fund befand sich in einem außerordentlich guten Zustand und war offenbar durch die Verschüttung mit überwiegend Stallmist um 1200 konserviert worden.
Alte Aufzeichnungen berichten von zwei Brücken, die Haithabu einst mit Schleswig verbunden haben sollen. Möglicherweise könnten damit aber einfach die Landungsbrücken gemeint sein. 2007 wurde eine um 1090 erbaute Landungsbrücke in Schleswig ausgegraben, die Teil einer Hafenanlage gewesen war. Der Fund befand sich in einem außerordentlich guten Zustand und war offenbar durch die Verschüttung mit überwiegend Stallmist um 1200 konserviert worden.
Der die Siedlung schützende Halbkreiswall verfügte über einen spitz nach innen zulaufenden Graben an der Außenseite und wurde im Laufe von zwei Jahrhunderten neunmal umgebaut, sei es durch Erhöhung oder Verstärkung. So war bei der ersten Stadtumwallung an ihrer Vorderseite eine Palisade befestigt, zudem verfügte sie über einen Wehrgang. Diese Stadtmauer wurde immer wieder ausgebaut, bis sie letztendlich eine vermutliche Höhe von 14 m erreicht hatte und über zwei übereinanderliegende Wehrgänge verfügte.
Die Gräber von Haithabu
Im westlichen Siedlungsgebiet wurden verschiedene Gräbertypen entdeckt. Über ein Gräberfeld wurden im Laufe des 10. Jahrhunderts Häuser gebaut, so dass von einer Besiedlung von Haithabu über mehrere Jahrhunderte ausgegangen werden kann. Neben dänischen Brandgruben und christlichen Erdgräbern wurden sächsische Urnengräber und schwedische Kammergräber gefunden. Dies lässt auf eine internationale Bevölkerung sowie den Einfluss der Christianisierung in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts schließen. Untersuchungen an Skeletten ergaben, dass die Bewohner selten über 40 Jahre alt wurden. Oft waren wohl vor allem die letzten Lebensjahre schmerzhaft mit Lähmungserscheinungen oder Tuberkuloseerkrankungen verbunden.
Die Runensteine von Haithabu
Die Runensteine von Haithabu stellen historische Zeugnisse und Gedenksteine dar. Auf Haithabu beziehen sich vier Runensteine, die in zwei Gruppen unterteilt und im Original im Wikinger-Museum in Haithabu ausgestellt sind. Nachbildungen befinden sich in etwa an der jeweiligen Fundstelle.
 Die Svensteine bestehen aus dem Erikstein und dem Skarthistein. Nach Auswertung verfügbarer Quellen kann vermutet werden, dass beide Steine sich auf eine Belagerung Haithabus beziehen, aus dem späten 10. oder zeitigen 11. Jahrhundert stammen und von ein und dem selben König Sven gestiftet wurden.
Die Svensteine bestehen aus dem Erikstein und dem Skarthistein. Nach Auswertung verfügbarer Quellen kann vermutet werden, dass beide Steine sich auf eine Belagerung Haithabus beziehen, aus dem späten 10. oder zeitigen 11. Jahrhundert stammen und von ein und dem selben König Sven gestiftet wurden.
Der Erikstein wurde schon 1796 zwischen Haithabu und dem Königshügel entdeckt. Auf dem Kreuzberg befanden sich drei Grabhügel, zwischen denen der umgefallene Erikstein gefunden wurde. Seine Kopie steht in Wedelspand an der Straße K1. Der Skarthistein wurde 1857 südlich von Busdorf nahe eines Grabhügels entdeckt. Möglicherweise gehörten die im Grab gefundenen Skelettüberreste zu jenem Skarthi, dem der Runenstein gewidmet war. Skarthi diente seinerzeit unter dem dänischen König Sven Gabelbart und fiel vermutlich im Kampf um Haithabu im Jahre 983. Der Skarthistein ist der einzige Runenstein in Deutschland, der, wenn auch als Nachbildung, an seinem ursprünglichen Platz im Freien in Busdorf steht.
 Die Sigtryggsteine sind die älteren Runensteine, die aus der Mitte oder dem Ende des 10. Jahrhunderts stammen. Sie beziehen sich auf Sigtrygg, Sohn der Königin Asfrid, die ihm diese Steine widmete. Der große Sigtryggstein mit schwedischen Runen wurde 1797 zwischen dem Haddebyer und dem Selker Noor entdeckt, eine Kopie befindet sich ebenda. König Sigtrygg wurde vermutlich um 940 vom neuen dänischen König Gorm aus Dänemark vertrieben. Er kam möglicherweise drei Jahre später bei einem Wikinger-Feldzug in der Normandie ums Leben. Der kleine Sigtryggstein, eine Kopie steht im Areal der Wikinger-Häuser, mit dänischen Runen entdeckte man 1887 eingemauert in den Fundamenten einer Bastion von Schloss Gottorf in Schleswig.
Die Sigtryggsteine sind die älteren Runensteine, die aus der Mitte oder dem Ende des 10. Jahrhunderts stammen. Sie beziehen sich auf Sigtrygg, Sohn der Königin Asfrid, die ihm diese Steine widmete. Der große Sigtryggstein mit schwedischen Runen wurde 1797 zwischen dem Haddebyer und dem Selker Noor entdeckt, eine Kopie befindet sich ebenda. König Sigtrygg wurde vermutlich um 940 vom neuen dänischen König Gorm aus Dänemark vertrieben. Er kam möglicherweise drei Jahre später bei einem Wikinger-Feldzug in der Normandie ums Leben. Der kleine Sigtryggstein, eine Kopie steht im Areal der Wikinger-Häuser, mit dänischen Runen entdeckte man 1887 eingemauert in den Fundamenten einer Bastion von Schloss Gottorf in Schleswig.
Die Hochburg von Haithabu
 Geht man am neuen Friedhof von Haddeby vorbei, gelangt man rasch zu einer natürlichen Anhöhe, der Hochburg von Haithabu. Vielleicht existierte hier bereits vor der Gründung Haithabus eine Fluchtburg. In dem flachen Wall am Abhang befanden sich möglicherweise drei Tore. Viele inzwischen stark verflachte Hügel zwischen den Bäumen lassen auf einen früheren Begräbnisplatz schließen.
Geht man am neuen Friedhof von Haddeby vorbei, gelangt man rasch zu einer natürlichen Anhöhe, der Hochburg von Haithabu. Vielleicht existierte hier bereits vor der Gründung Haithabus eine Fluchtburg. In dem flachen Wall am Abhang befanden sich möglicherweise drei Tore. Viele inzwischen stark verflachte Hügel zwischen den Bäumen lassen auf einen früheren Begräbnisplatz schließen.
Die Wiederentdeckung von Haithabu
Nachdem Haithabu zerstört und nicht wieder aufgebaut worden war, verfiel die aufgegebene Siedlung zum Ende des 11. Jahrhunderts auch auf Grund des Wasseranstiegs von Ostsee und Schlei. Der Hafenbereich sowie das Siedlungsgelände gingen oberirdisch vollständig verloren. Schließlich geriet der Ort gänzlich in Vergessenheit. Irrtümlich war die halbkreisförmige Wallanlage lange Zeit im Volksmund als die “Oldenburg” bezeichnet worden.
1897 vermutete der dänische Archäologe Sophus Müller das alte Haithabu innerhalb des Halbkreiswalls. Seine Annahme wurde erst drei Jahre später bestätigt, woraufhin bis 1915 umfangreiche Grabungen stattfanden, um die Rolle Haithabus für die Geschichte Dänemarks zu erforschen.
Grabungen unter Herbert Jankuhn
 Weitere intensive, umfassende Ausgrabungen im Bereich des Halbkreiswall fanden zwischen 1930 und 1939 unter Herbert Jankuhn statt, wobei diese seit 1934 unter der Schirmherrschaft von SS-Reichsführer Heinrich Himmler standen. Im Jahr darauf verlieh Himmler dem wiederentdeckten Haithabu den Status “Deutsche Kulturstätte”. Jankuhn wurde 1945 verhaftet und die Grabungen unter Kurt Schietzel fortgeführt. Nachdem Jankuhn 1948 entlassen wurde, konnte er im folgenden Jahr seine Arbeit in Haithabu wieder aufnehmen.
Weitere intensive, umfassende Ausgrabungen im Bereich des Halbkreiswall fanden zwischen 1930 und 1939 unter Herbert Jankuhn statt, wobei diese seit 1934 unter der Schirmherrschaft von SS-Reichsführer Heinrich Himmler standen. Im Jahr darauf verlieh Himmler dem wiederentdeckten Haithabu den Status “Deutsche Kulturstätte”. Jankuhn wurde 1945 verhaftet und die Grabungen unter Kurt Schietzel fortgeführt. Nachdem Jankuhn 1948 entlassen wurde, konnte er im folgenden Jahr seine Arbeit in Haithabu wieder aufnehmen.
Dass das Gebiet des früheren Haithabus nie überbaut worden war und aufgrund der Nässe der Uferbereich gut erhalten blieb, waren äußerst günstige Voraussetzungen für die Archäologen. Ab 1959 wurden die gesamte Südsiedlung außerhalb des Halbkreiswalles sowie ein beträchtlicher Teil des alten Siedlungskerns innerhalb des Walles ausgegraben.
Auf einer Tauchfahrt 1953 im Hafen wurden Reste der Hafenpalisade sowie das Wrack eines Wikingerschiffes entdeckt, welches einst nach einem Brand untergegangen war. Erst 1979, über ein Vierteljahrhundert später, bot sich die Möglichkeit das Wrack zu heben und zu bergen. Das 24 m lange und 6 m breite Langschiff wurde konserviert, rekonstruiert und im Wikinger-Museum Haithabu ausgestellt. Außerdem wurden Landestege, Schiffbrücken, Befestigungsanlagen, Speichergebäude und Werkstätten gefunden.

Bootkammergrab
Als eines der wichtigsten Gräber gilt das Bootkammergrab, das als niedrige ovale Erhebung südlich des Halbkreiswalles zu erkennen ist. Es wurde 1908 entdeckt und gilt als in seiner Form einmalig. Die hölzerne Grabkammer war in einen kleineren und einen größeren Teil unterteilt und enthielt die Beigaben der vermutlich drei Bestatteten. Gefunden wurden unter anderem Pfeile, Schwerter, Silberschmuck und ein Holzeimer. Neben der Grabkammer wurden die Skelette dreier Pferde identifiziert.
Über der Grabkammer wurden die Reste eines etwa 16 m langen und ungefähr 3 m breiten Bootes aufgefunden, dessen genaue Größe sich aufgrund des Grades der Zerstörung nicht mehr ermitteln lässt. Die Beisetzung wird zwischen das späte 9. und das frühe 10. Jahrhundert datiert. Wer in diesem Bootkammergrab bestattet worden war, lässt sich nicht klären. In keinem anderen bekannten Fall wurden die Toten unterhalb eines Bootes beigesetzt. Doch anhand der wertvollen Beigaben wird über einen höheren sozialen Stand spekuliert. Ab 2005 wurde erneut gegraben. Damit sollten unter anderm der “Stadtplan” überprüft werden, dessen Anfertigung 2002 begann.
Haithabu und seine Gegenwart
 In unmittelbarer Nähe des Halbkreiswalles in Haddeby befindet sich das Wikinger-Museum Haithabu. Dort werden seit 1985 die wichtigsten Funde aus und die Geschichte der Siedlung vorgestellt. Das 1979 aus dem Hafenbecken geborgene Langschiff wird in der Schiffshalle gezeigt.
In unmittelbarer Nähe des Halbkreiswalles in Haddeby befindet sich das Wikinger-Museum Haithabu. Dort werden seit 1985 die wichtigsten Funde aus und die Geschichte der Siedlung vorgestellt. Das 1979 aus dem Hafenbecken geborgene Langschiff wird in der Schiffshalle gezeigt.
In den frühen 2000er Jahren wurden im Halbkreiswall von Haithabu sieben Wikingerhäuser anhand archäologischer Befunde rekonstruiert. Auch Holzstege, eine Mole, ein befestigter Bachlauf und Landungsstege wurden nach historischem Vorbild hergestellt. Die Arbeiten gestalteten sich schwierig, da viele der im Frühmittelalter üblichen Handwerkstechniken nicht mehr praktiziert werden. Die Eröffnung der Wikingerhäuser fand 2008 statt. Im selben Jahr wurde ein 6,50 m langes Wikinger-Boot auf der Museumswerft in Flensburg nachgebaut. Es liegt seit 2009 in Haithabu.
Stadttore
 Im Halbkreiswall sind noch die Durchlässe erkennbar, die einst als nördliches und südliches Stadttor genutzt wurden. Sie befanden sich dort, wo ein alter Weg durch die Stadt verlief und im Norden und im Süden jeweils den Wall schneidet. Im Westbereich ist in etwa noch die ursprüngliche Höhe der Wallanlage erhalten, auch der sich vor ihr befindliche Graben ist noch gut erkennbar. Insgesamt ist der Wall heute zwischen 6 und 11 m hoch und reichte einst bis zum Haddebyer Noor hinab, jedoch wurden seine Enden abgetragen. Etwa mittig des Halbkreiswalls zweigt der Margarethen- oder Verbindungswall des Danewerks ab. Von dort kann man zum 1,3 km entfernten Busdorfer Runenstein, dem Skarthistein, wandern.
Im Halbkreiswall sind noch die Durchlässe erkennbar, die einst als nördliches und südliches Stadttor genutzt wurden. Sie befanden sich dort, wo ein alter Weg durch die Stadt verlief und im Norden und im Süden jeweils den Wall schneidet. Im Westbereich ist in etwa noch die ursprüngliche Höhe der Wallanlage erhalten, auch der sich vor ihr befindliche Graben ist noch gut erkennbar. Insgesamt ist der Wall heute zwischen 6 und 11 m hoch und reichte einst bis zum Haddebyer Noor hinab, jedoch wurden seine Enden abgetragen. Etwa mittig des Halbkreiswalls zweigt der Margarethen- oder Verbindungswall des Danewerks ab. Von dort kann man zum 1,3 km entfernten Busdorfer Runenstein, dem Skarthistein, wandern.
Bedeutendes Bodendenkmal
Gemeinsam mit dem Danewerk zählt Haithabu zu den wichtigsten Bodendenkmälern in Schleswig-Holstein. Island setzte sich seit 2008 mit Dänemark, Deutschland, Norwegen, Schweden und Lettland dafür ein, um Haithabu und das Danewerk als bedeutende Stätten der Wikinger-Kultur als UNESCO-Welterbe anerkennen zu lassen. 2011 setzten diese Länder ihre Bodendenkmäler auf die Vorschlagslisten. 2018 erkannte die UNESCO Haithabu und das Danewerk als außergewöhnliche Welterbestätte an.
Wikinger Museum Haithabu
Am Haddebyer Noor 5
24866 Busdorf
www.haithabu.de
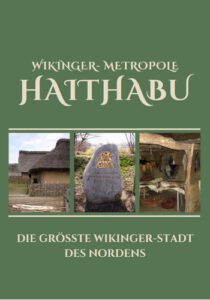
In eigener Sache:
Dieser Artikel ist mit weiteren Bildern als umfangreiche Ausarbeitung auf 44 Seiten im PDF-Format auf Anfrage erhältlich.
Im Gegenzug bitte ich um eine kleine Spende an die Noteselhilfe, an die Igelhilfe Radebeul oder an ein Tierheim Ihrer Wahl.