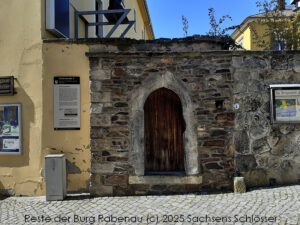Schloss Thürmsdorf
Schloss Thürmsdorf
Am Schlossberg 9
01796 Struppen OT Thürmsdorf
Historisches
Thürmsdorf wurde erstmals 1420 in einem Lehnsbrief erwähnt. In diesem hieß es, Friedrich von Rottwerndorf habe das Vorwerk Termestorff erhalten. Grundherrschaftlich unterstand Thürmsdorf zunächst dem Rittergut Kleinstruppen, bevor es im Jahre 1606 erstmals als eigenständiges Rittergut beurkundet wurde. Als Sitz bildete sich das Thürmsdorfer Schloss heraus.
Die Besitzer wechselten oft. Im frühen 16. Jahrhundert gehörte das Vorwerk Thürmsdorf den Herren von Bernstein (Bärenstein). 1548 wurde namentlich Walter von Bernstein als Besitzer genannt. Das Vorwerk ging noch im 16. Jahrhundert an die verschwägerte Familie von Kitzscher über, unter der das damalige Herrenhaus 1583 abbrannte. Im 17. Jahrhundert entstand ein Vorgängerbau des heutigen Schlosses. Als Besitzer traten um 1623 Hans Christoph von Kitzscher, die Familie von Carlowitz und die Familie von Buchner in Erscheinung, welche das Rittergut 1728 an Johann Christian Blechschmidt verkaufte. Der Major von Pohlen wurde 1767 als Besitzer des Ritterguts verzeichnet.
 1801 befand sich das Schloss im Besitz des Grafen von Holtzendorf, dem die Familie von Friesen folgte. Heinrich Laurent Le Fèvre kaufte Schloss Thürmsdorf 1828. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts befand sich Schloss Thürmsdorf im Besitz von Rudolf Ritter Bradsky von Laboun. Zwischen 1899 und 1900 veranlasste er umfassende Umbauten im vorderen Bereich des Schlosses, er musste es aus finanziellen Gründen jedoch 1907 wieder verkaufen. Neuer Eigentümer wurde Freiherr Erich von Biedermann, welcher zwischen 1908 und 1911 dem rückwärtigen Schlossanbau errichten ließ. Er verstarb 1931. Noch im gleichen Jahr erwarb Hans-Arno von Arnim Schloss Thürmsdorf und bewohnte es bis 1945.
1801 befand sich das Schloss im Besitz des Grafen von Holtzendorf, dem die Familie von Friesen folgte. Heinrich Laurent Le Fèvre kaufte Schloss Thürmsdorf 1828. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts befand sich Schloss Thürmsdorf im Besitz von Rudolf Ritter Bradsky von Laboun. Zwischen 1899 und 1900 veranlasste er umfassende Umbauten im vorderen Bereich des Schlosses, er musste es aus finanziellen Gründen jedoch 1907 wieder verkaufen. Neuer Eigentümer wurde Freiherr Erich von Biedermann, welcher zwischen 1908 und 1911 dem rückwärtigen Schlossanbau errichten ließ. Er verstarb 1931. Noch im gleichen Jahr erwarb Hans-Arno von Arnim Schloss Thürmsdorf und bewohnte es bis 1945.
Zwischen Thürmsdorf und Königstein befand sich für einige Monate ein Arbeitslager als Außenstelle des KZ Flossenbürg. Die Häftlinge mussten zum Aufbau einer unterirdischen Fabrikanlage Stollen in den Steinbruch im Ortsteil Strand treiben. Die Bauleitung soll seinerzeit ihren Sitz im Schloss Thürmsdorf gehabt haben.
 Nach 1945
Nach 1945
Nach Kriegsende diente Schloss Thürmsdorf zunächst als Betriebsferienheim des Synthesewerks Schwarzheide und wurde danach in ein FDGB-Erholungsheim umgewandelt. Auch die Grundschule der Gewerkschaft Forst- und Landwirtschaft nutzte Räume im Schloss.
Die Ausflugsgaststätte auf dem nahe gelegenen Kleinen Bärenstein, welche zum Rittergut Thürmsdorf gehörte, wurde nach Kriegsende geplündert und schließlich bis auf wenige Mauerreste abgetragen.
Nachwendezeit
Das FDGB-Ferienheim wurde zur Wendezeit geschlossen. Ab 1992 stand Schloss Thürmsdorf leer und ungenutzt. Das Gelände wurde zeitweise für Ritterspiele genutzt. 1997 wurde es von einem Unternehmer erworben. Das ursprünglich geplante Konzept eines Hotels konnte nicht umgesetzt werden.
 Biedermann-Mausoleum / Malerweg-Kapelle
Biedermann-Mausoleum / Malerweg-Kapelle
Unter Freifrau Helene von Biedermann wurde in den Jahren 1920 und 1921 östlich des Schlosses auf einer Felsklippe am Elbhang mit Blick auf die Festung Königstein ein Familien-Mausoleum errichtet. Bereits im Jahr der Fertigstellung wurde Helene Freifrau von Biedermann darin beigesetzt. Freiherr Erich Moritz von Biedermann folgte ihr zehn Jahre später. Die sterblichen Überreste wurden in den 1970er Jahren nach Plünderungen des Mausoleums auf den Friedhof von Königstein umgebettet. Infolge von Leerstand, Vandalismus und Sturmschäden verfiel das Gebäude. Sicherungsarbeiten erfolgten 1994 und 1995.
Mit Fördermitteln von Bund und Freistaat im unteren sechsstelligen Bereich konnte das Biedermann-Mausoleum restauriert werden. Im Juni 2016 wurde es als Kapelle geweiht und ist unter dem neuen Namen Malerweg-Kapelle öffentlich zugänglich.
 Schlosspark
Schlosspark
Der 3,5 Hektar große Schlosspark mit Teich, Rosengarten und heute altem, wertvollen Baumbestand wurde vom königlich-sächsischen Gartenbaudirektor Max Bertram von 1908 bis 1912 angelegt. 2020 wurden Teile der Terrasse saniert. Seit einigen Jahren findet regelmäßig im Herbst das Parkseminar statt.
Heutige Nutzung
Schloss Thürmsdorf wird gelegentlich für Veranstaltungen genutzt. Sanierungsarbeiten sind mithilfe von Fördergeldern im Gange. Das Dach wurde 2024 erneuert. Die großzügige Parkanlage wird gepflegt und lädt zu Spaziergängen ein.
(Stand: Dezember 2024)
 Burg Arnstein
Burg Arnstein

 Rotes Gut
Rotes Gut

 Burgwarte Hausberg
Burgwarte Hausberg