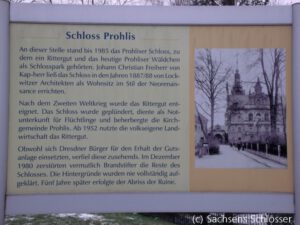Coselpalais
Coselpalais
An der Frauenkirche 12
01067 Dresden
Historisches
Das Coselpalais geht in seinen frühen Ursprüngen auf den Pulverturm zurück, welcher in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts errichtet worden war. Er diente zunächst als Mühle, im frühen 17. Jahrhundert dann seinem Namen entsprechend. Kurfürst Friedrich August II. schenkte den Turm Johann Christoph Knöffel, der ihn 1744 abreißen ließ. In den folgenden beiden Jahren entstanden auf den Pulverturm-Grundmauern unter Knöffel zwei Gebäude, die 1760 im Siebenjährigen Krieg stark beschädigt wurden. Dabei handelte es sich um das Cäsarsche Haus einerseits und das Knöffelsche Haus andererseits, welche beide 1746 errichtet worden waren. Im Erdgeschoss der palaisähnlichen Wohngebäude befanden sich sogenannte Verkaufsgewölbe. Friedrich August von Cosel, Sohn der Gräfin Cosel und August des Starken, kaufte die beiden Gebäude zwei Jahre später und ließ sich daraus bis 1764 ein Wohnpalais errichten. Es erhielt zwei Flügelbauten sowie einen Festsaal im ersten Obergeschoss.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts befand sich das Palais in bürgerlichem Besitz. Für einige Jahre, von 1845 bis 1853, war im Coselpalais das “Russische Hotel” eingerichtet. 1853 ging das Coselpalais in sächsischen Staatsbesitz über und wurde zum königlichen Polizeihaus ausgebaut. Nachdem das in Nachbarschaft gelegene Polizeipräsidium 1900 fertig gestellt wurde, sollte das Coselpalais ursprünglich abgerissen werden, doch namhafte Bürger haben sich erfolgreich für seinen Erhalt eingesetzt. In der Folgezeit bezog unter anderem das Bauamt das Palais.
 Nach 1945
Nach 1945
Im Februar 1945 wurde das Coselpalais durch Bombenangriffe zerstört. Lediglich die beiden Flügelbauten blieben stehen, brannten aber vollkommen aus. Sie wurden in den 1970er Jahren rekonstruiert.
Nachwendezeit
Mit der Wiederherstellung des gesamten Gebäudes wurde 1998 begonnen, nachdem die Ruine des Coselpalais in Privatbesitz gelangt war. Die Sanierung mit gehobener Ausstattung konnte zu Beginn des Jahres 2000 abgeschlossen werden.
Heutige Nutzung
Das Coselpalais befindet sich in Privatbesitz. Es wird für stilles Gewerbe genutzt und verfügt über ein Restaurant und ein Café.